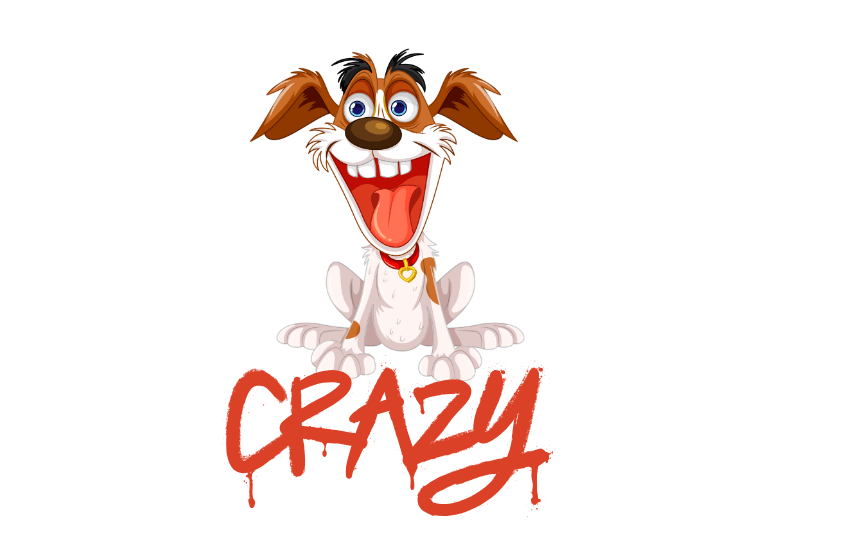Dummytraining klingt für viele Hundehalter*innen zunächst wie eine Beschäftigung „nur für Retriever“. In Wahrheit steckt dahinter eine wunderbare, strukturierte Möglichkeit, fast jeden apportierfreudigen Hund körperlich wie geistig sinnvoll auszulasten – ganz ohne Jagdambitionen.
Was es mit dem Training auf sich hat, warum dein Hund davon enorm profitiert und wie du den Einstieg sauber und mit Freude gestaltest, erfährst du hier.
🐾 Was ist Dummytraining überhaupt?
Dummytraining ist eine Beschäftigungsform, bei der der Hund lernt, einen sogenannten Dummy (meist ein canvasartiger Beutel, der Wild simuliert) auf Signal zu suchen, aufzunehmen und zum Menschen zurückzubringen. Ursprünglich stammt diese Trainingsform aus der jagdlichen Arbeit mit Retrievern, eignet sich heute aber auch hervorragend für alle apportierfreudigen Hunde mit Freude an gemeinsamer Teamarbeit.
Dabei wird unterschieden zwischen:
- Markieren (Hund sieht, wo der Dummy fällt)
- Einweisen (Hund wird ohne Sicht auf die Fallstelle per Körpersprache geschickt)
- Freiverlorensuche (Hund soll selbstständig ein Gebiet absuchen)
🧠 Warum ist Dummytraining mehr als „Stöckchen werfen“?
Im Gegensatz zum klassischen Ballspiel bringt Dummyarbeit Struktur, Sinn und geistige Forderung ins Spiel. Es schult:
- Impulskontrolle („Ich darf erst los, wenn ich geschickt werde.“)
- Konzentration und Frustrationstoleranz
- Orientierung auf Distanz (auch visuelle Signale lernen!)
- enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund
- eine saubere Rückgabe ohne Kauen oder Weglaufen
Gutes Dummytraining macht aus dem Hund keinen Reizjunkie – sondern einen echten Teamplayer.
🚀 Der Einstieg: So legst du die Basis richtig
Bevor du mit Würfen und großen Suchen loslegst, brauchst du eine stabile Grundlage. Hier sind die wichtigsten Schritte für den Trainingsstart:
1. Der richtige Dummy
Für den Einstieg eignet sich ein Standard-Canvas-Dummy (250–500 g). Am Anfang kann er ruhig gut sichtbar sein. Später kommen Gelände, Geruch und Variation ins Spiel.
Tipp: Vermeide Spielzeug oder Bälle – sie fördern wildes Hetzen und hektisches Verhalten.
2. Tragen & Halten
Der Hund sollte lernen, den Dummy ruhig zu halten und nicht zu knautschen. Übe das Halten erst im Sitzen – z. B. mit ruhiger Bestärkung und Lob für Zurückhaltung.
➡️ Belohnung kommt nur, wenn der Dummy nicht fallengelassen oder bearbeitet wird.
3. Der kontrollierte Start
Ein Hund, der selbstständig losrennt, ist kein Partner. Übe von Anfang an, dass dein Hund erst auf dein Freigabesignal startet – das verhindert spätere Fehler wie voreiliges Losstürmen.
Kleinschrittiger Aufbau:
- Dummy sichtbar fallen lassen
- Hund bleibt sitzen
- Erst nach Signal darf er los
4. Rückruf & Abgabe
Ein sauberer Rückweg ist genauso wichtig wie das Holen selbst. Der Hund sollte möglichst zügig zurückkommen, sich vor dir setzen oder stehenbleiben und dir den Dummy direkt in die Hand geben.
Tipp: Nutze eine definierte Abgabehilfe („Gib!“) und lobe bei jeder sauberen Übergabe.
5. Konzentration statt Aktion
In der Anfangsphase ist weniger mehr. Ein oder zwei kurze Einheiten reichen völlig – mit viel Ruhe dazwischen. Besser ein gut ausgeführter Dummy als fünf wilde Rennspiele.
👀 Typische Anfängerfehler:
- Zu viel werfen = Reizüberflutung
- Fehlende Freigabe = Kontrollverlust
- Abgabe wird nicht trainiert → Hund lässt Dummy fallen oder läuft weg
- Dummytraining im Spielmodus = Überdrehen statt Kooperation
- Zu schnell zu schwer → Hund wird unsicher oder verliert Motivation
✅ Mini-Übung für Einsteiger:
🟢 Vorbereitung: Leine, Dummy, ruhiger Ort
🟢 Ablauf:
- Lass den Hund sitzen
- Wirf den Dummy 2–3 Meter sichtbar
- Halte Blickkontakt – kein sofortiges Losrennen!
- Gib das Freigabesignal („Hol’s!“)
- Belohne Rückweg und ruhige Abgabe direkt in die Hand
🎯 Ziel: Dein Hund merkt: Ich warte auf mein Startsignal – und mein Mensch freut sich riesig, wenn ich mit dem Dummy zurückkomme.
📣 Fazit: Dummyarbeit ist gemeinsame Kommunikation, keine Rennveranstaltung
Dummytraining ist viel mehr als ein beliebiger Zeitvertreib. Es ist ein durchdachtes, ruhiges Zusammenspiel von Orientierung, Vertrauen, Struktur und Freude an der Aufgabe. Und: Es macht süchtig – im besten Sinne.
Wenn du von Anfang an sauber aufbaust, wird dein Hund nicht nur apportieren – er wird es mit dir gemeinsam tun. Und das ist der wahre Zauber an dieser Trainingsform.
💬 Neugierig geworden?
In unseren Dummytrainings lernst du Schritt für Schritt, wie du deinem Hund die Grundlagen sinnvoll, fair und mit Spaß vermittelst – ob als Familienhund oder als Retriever mit jagdlicher Ader. Sprich uns einfach an!
🐾